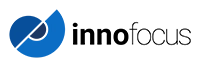Ob Carsharing oder Mietfahrrad: Pay-per-Use als Geschäftsmodell ist den meisten von uns bereits ein Begriff. Anstatt z. B. ein Auto zu kaufen, zahlt man bei diesem Modell nur für die Nutzung, die dann nach bestimmten Messgrößen wie Zeit oder gefahrenen Kilometern abgerechnet wird. Für die Kunden bedeutet Pay-per-Use, nur noch für die eigentliche Nutzung zu bezahlen. Für die Anbieter ergeben sich nicht nur neue, sondern vor allem auch kontinuierliche Einnahmequellen. Inzwischen ist Pay-per-Use als Idee auch längst in der Produktion angekommen.
So kann Pay-per-Use in der Produktion aussehen
Mögliche Szenarien für Pay-per-Use in der Produktion sind vielfältig. Nehmen wir an, ein Werkzeughersteller möchte die Nutzung von beispielsweise Fräsern oder Bohrern nicht mehr pro Stück abrechnen, sondern die Kosten z. B. vom Weg oder der Standzeit abhängig machen. Oder ein Anlagenhersteller verkauft nicht mehr seine Anlagen pro Stück an die Kunden, sondern rechnet stattdessen anhand der Laufzeit der Anlage ab. In diesem Fall bleibt den Nutzern der Anlage der einmalig sehr hohe Anschaffungspreis erspart und der Anlagenhersteller profitiert von einem kontinuierlichen Cashflow.
Allerdings bedarf ein solches Geschäftsmodell einiger technischer Voraussetzungen, die nicht immer gegeben sind.
Welche Voraussetzungen benötigt Pay-per-Use?
Die wahrscheinlich größte Hürde für Pay-per-Use ist, dass es für die Abrechnung notwendig ist, die Nutzung des Werkzeugs oder der Anlage genau und lückenlos aufzuzeichnen und diese Daten dem jeweiligen Hersteller zur Verfügung zu stellen. Hier läuten bei Daten- und Know-how-Schützern häufig die Alarmglocken. Ein solches Tracking birgt große Risiken im Bezug auf Geschäfts- und Produktionsgeheimnisse.
Die erfolgreiche Einführung von Pay-per-Use hängt also maßgeblich davon ab, ein datensicheres, vertrauenswürdiges Umfeld dafür anzubieten.
Pay-per-Use kann zu Verzerrungen führen
Doch auch der Pay-per-Use-Ansatz kann problematisch sein. Ein Beispiel aus dem Carsharing: Zwar fahren einige Kunden nur ein paar Kilometer und zahlen somit nicht viel für die Nutzung, möglicherweise lässt ihr Fahrstil aber stark zu wünschen übrig, sodass die Reifen, Bremsen oder andere Verschleißteile übermäßig belastet werden. Der Anbieter wird also einen solchen Wagen früher warten oder gar ganz austauschen müssen als einen Wagen, der pfleglich behandelt wird. Somit entstehen für den Anbieter auch höhere Kosten als eigentlich vorgesehen.
Gleiches gilt auch für Werkzeuge und Anlagen. Auch hier kann unter Umständen der Verschleiß groß sein, insbesondere, wenn dies für den Nutzer keinerlei Konsequenzen hat. Daher ist neben Pay-per-Use auch Pay-per-Stress (Link zu einem gleichnamigen Forschungsprojekt des BMWK. Die Seite umreißt die Thematik knapp und präzise.) interessant. Durch das Tracking entsprechender Parameter ist es möglich, den Verschleiß von Werkzeugen oder Anlagen zu messen. Jedoch müssen diese von den Anbietern sorgfältig definiert werden.
Fazit
Insgesamt sind sowohl Pay-per-Use als auch Pay-per-Stress attraktive Geschäftsmodelle für Werkzeug- und Anlagenhersteller und ihre Kunden. In der Umsetzung müssen die Beteiligten insbesondere auf den Know-how-Schutz und ein vertrauensvolles sowie datensicheres Umfeld (in Form einer IIoT-Plattform) achten.
Sie wünschen Beratung zu Pay-per-Use oder Pay-per-Stress in der Produktion? Dann kontaktieren Sie uns.